Wo wir gerade bei verrückt waren.
Gestern habe ich meinen Tag in Chernobyl verbracht. Vorgestern, das sollte ich der Vollständigkeit halber vielleicht noch erwähnen, schlenderte ich den ganzen Tag durch Kiev und von Museum zu Museum zu Museum. Das fasse ich mal in Bildern zusammen, einfach, weil mir sonst noch die Finger ganz lahm werden, schließlich gibt es schon aus Chernobyl genug zu berichten:
Okay. Also. Chernobyl. Für 90 Dollar hatte ich eine Tagestour gebucht, obwohl mir Tagestouren buchen eigentlich wirklich gegen den Strich geht, das hat immer sowas von Massentourismus. Aber im Falle Chernobyl hilft alles nichts, denn nur mit einer jener Touren kommt man in die 30km Exclusion Zone, die militärisch Bewacht ist und den Reaktor umgibt. Also wachte ich um sechs Uhr auf, erhob mich von meinem Nest auf dem Boden, packte meine sieben Sachen und machte mich auf den Weg zum Treffpunkt, an den wir zu 7:30 Uhr bestellt worden waren. Ich legte einen kurzen Zwischenstop im Supermarkt ein, um mich mit ausreichend Wasser und Essen für den Tag zu versorgen, und ließ mich dann von meinem Uber-Fahrer absetzen.
Ein Wort zum Uber in der Ukraine. Für alle, die nicht wissen, wovon ich spreche: Taxi. Eine Taxifahrt von irgendwo in der Stadt an irgendeinen anderen Ort in der Stadt hat mich hier nie mehr als 2€ gekostet. Das ist weniger als eine Strecke mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Berlin. Die öffentlichen Verkehrsmittel in Kiev kosten 8 Hryvna, also ca. 27 cent pro Fahrt. Nur mal so zum Vergleicht.
Also. Ich war also am Treffpunkt, irgendwo in der Nähe zum Hauptbahnhof in Kiev, noch so ein beeindruckend sowjetisches Gebäude, das vor allem erstmal einschüchternd wirkt.
Es war kalt auf dem Parkplatz, und langsam sammelten sich mehr und mehr Reisende, die ganz aufgeregt auf ihren Ausflug nach Chernobyl warteten. Ich fand meinen Bus, oder was davon übrig war – ein rappeliges, dunkelblaues Gefährt mit Rostflecken, blinden Fenstern und Gardienen die aussahen, als hätten sie ihre Position seit etwa 30 Jahren nicht verändert. In jenem Bus wartete ein ausgesprochen aufgeregter Mann auf mich, der als Konversationspartner etwa so emotionslos maschinell funktionierte wie eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn, nur war er etwas lauter. „HALLO WILLKOMMEN ZUR CHERNOBYL TOUR KANN ICH BITTE DEINEN AUSWEIS SEHEN“ Dienstbeflissen händigte ich ihm meinen Reisepass aus „OKAY VIELEN DANK KLARA AUS DEUTSCHLAND JA JA DAS STIMMT HIER ALLES“ rief er mit Blick auf die etwas unübersichtlich aussehende Liste auf seinem Schoß „WILLST DU EINEN GEIGERZÄHLER ODER EIN MITTAG DAZUBUCHEN“ (ich verwende hier absichtlich keine Satzzeichen, denn die suggerieren einen einigermaßen menschlichen und fließenden Sprachduktus, den man im Falle dieses Mannes wirklich vergeblich suchte)
„Ich, äh, einen Geigerzähler, sicher. Und wsa gibt’s denn zum Mittag?“
„WIR HABEN EINE NORMALE UND EINE VEGETARISCHE VARIANTE HIER WENN DU ESSEN CHERNOBYL GOOGELST KANNST DU ES SEHEN MOMENT ICH MACH DAS HIER GUCK ES IST EINE SUPPE UND EIN HAUPTANG UND EIN SALAT UND LIMONADE“ – sprach’s , und hielt mir sein Handydisplay unter die Nase. Ich hatte einen sofortigen Flashback zu meiner Kindergarten- und Grundschul-Mittagsversorgung im Vorpommern der späten 90er Jahre. Der einzige Farbklecks waren eingelegte Rote Beete und der obligatorische Nachtisch, der mir noch ganz deutlich als „Fruchtkompott“ in Erinnerung war, aber im Prinzip aus einer Sorte eingelegtem Obst aus der Dose bestand. Ich lehnte dankend ab.
„OKAY DANN MACHT DAS 200 HRYVNA FÜR DEN GEIGERZÄHLER“
In Ordnung. Ich händigte diesem aufgeregten Herrn sein Geld aus, umgerechnet etwa 6,60€, und fragte, ob noch etwas Zeit wäre, um eine Toilette zu finden.
„JA NATÜRLICH SIEHST DU DA UNTEN DIE LEUCHTEND ROTEN BUCHSTABEN AN DER ECKE DA GEHST DU HIN DANN GEHST DU NACH RECHTS, ÖFFENTLICHES KLO, KEINE TOILETTE, UKRAINISCHES BAHNHOFSKLO, KOSTET 4 HRYVNA“
Großartig. Wenn jemand sagt „Keine Toilette, ukrainisches Bahnhofsklo“ ist das im Allgemeinen kein gutes Zeichen, so viel konnte ich bereits von meinen vergangenen Reisen auf dieses ukrainische Abenteuer extrapolieren. Doch mangels einer Alternative wanderte ich los, denn ich hatte bereits am Vortag eine öffentliche Toilette besuchen dürfen, in einem der Klöster Kievs, und ich erkläre euch mal eben, wie das so aussieht.
Man kommt an, und eine kleine, grimmig dreinschauende Oma mit null Englischkenntnissen sitzt in authentisch violett-pinker Kittelschürze in einem Kasten mit Fenster, an dem der Preis für ein Klobesuch geschrieben steht, im Allgemeinen zwischen 3 und 5 Hryvna (10-17 Cent). Man händigt ihr das Geld aus, sie nickt. Das war’s dann mit der Interaktion. Ebenfalls am Kasten befestigt ist ein Klopapierhalter aus Plastik, der schon bessere Tage gesehen hat. An diesem zentralen Papier-Arsenal bedient man sich dann zu so viel Klopapier, wie man zu nutzen gedenkt. Man ist sich also bestenfalls schon bei Ankunft darüber im Klaren, welches Geschäft man eigentlich so verrichten will und wie der persönliche Klopapierverbrauch dafür ausfallen könnte. Dabei muss man als dummer Ausländer jedoch unbedingt die ukrainische Klopapier-Qualität mit einkalkulieren. Dahingehend hatte mich der Aufenthalt bei Hlafira und Zhenya bereits geschult, es handelt sich um einlagiges, dunkelgraues Krepppapier ohne Loch in der Mitte. Ich habe das mal für all jene Abgelichtet, die in ihrem Leben noch nicht die Freude hatten, sich in einem sowjetischen oder post-sowjetischen Land den Hintern abzuputzen.
Dann das Klo. Das ist für Reiseerfahrene unspektakulär, jedoch auch nicht gerade bequem, denn es handelt sich um ein Loch im Boden, welches ich so nur aus südostasiatischen Gefilden und abgelegenen, italienischen Dörfern kenne. Ist man mit der Benutzung fertig, wäscht man sich die Hände in einem quasi immer spiegellosen Raum, in dem es kein Papier zum Abtrocknen gibt, schließlich wird schon mit dem Klopapier-Krepp streng gehaushaltet. Also wedelt man seine Hände trocken, sehr zum Unbehagen der grimmigen Großmutter, doch auch sie weiß, dass einem die gegebenen Umstände wenig Alternativen lassen. Fertig.
Nach diesem Abenteuer also wanderte ich zurück zum Bus, wo sich mittlerweile weitere Reisende eingefunden hatten. Ich weiß nicht, was es ist, aber immer, wenn man diese Tagestouren bucht, ist eine Gruppe aus vier bis sechs jungen Männern dabei, die nur Unfug betreiben. Dieses Mal handelte es sich um Dänen, ganz was neues.
Ich jedenfalls fand einen Platz ganz hinten im Gefährt, neben einer Tierpflegerin aus dem Christchurch Zoo in Neuseeland. Hatte ich bisher auch noch nicht. Also nur Neuheuten bis zu diesem Zeitpunkt, und nachdem wir alle Instruktionen dazu erhalten hatten, wie unsere Geigerzähler zu bedienen seien, ging es los nach Chernobyl.

Die Fahrt dauert knappe zwei Stunden, und auf dem Weg zur Exclusion Zone wurde uns eine Dokumentation zum Unglück gezeigt, von der ich nur etwa ein Viertel verstand, da ich mich ja ganz am hinteren Ende des Busses einquartiert hatte. Sollte mir Recht sein, ich hatte einen schwarzen Kaffee von der Tankstelle in der Hand und beobachtete interessiert die ukrainische Landschaft, die an mir vorbeizog.
Als „Straße“, habe ich gelernt, bezeichnen die Ukrainer das, was zwischen den Schlaglöchern noch so übrig ist. So unwichtig wie knietiefe Absenkungen im Asphalt sind auch Geschwindigkeitsbegrenzungen, derartige Hinweisschilder dienen eher dekorativen Zwecken. Ansonsten war, was ich da vor dem Fenster sah, eher karg und ärmlich. Ich weiß, das ist ganz sicher nicht repräsentativ für das gesamte Land, welches gerade landschaftlich so einiges zu bieten hat, aber hier, auf dem Weg von Kiev nach Chernobyl war es eben trist, und jedes Gebäude sah aus, als hätte es eigentlich schon vor 15 Jahren mal eine Grundüberholung gebrauchen können. Viel zusammengeschustert, viel grau, viel Rost, und unbehaglich schwarze Rauchwolken aus den Schornsteinen.
Irgendwann erreichten wir die erste Militärkontrolle, 30km Exclusion Zone. Also alle raus aus dem Bus, in einer Reihe aufgestellt, mit Pässen in der Hand, damit ein schwer bewaffneter Soldat uns alle einen nach dem anderen kontrollieren und uns dann mit einem Wink wieder zurück in den Bus dirigieren konnte. An der Absperrung wurden gerade „Erneuerungsmaßnahmen“ vorgenommen, und zwei Arbeiter um die 60 liefen mit pechschwarzen Metallkannen herum, aus denen sie heißen Teer auf ein paar Flicken in der Straße gossen, so frei Hand.
Hinter dem Zaun dann kurze Pipipause und einsammeln der persönlichen Strahlungsmesser, die wir uns um den Hals hängten und die den Tag über die gesamte Strahlung messen sollten, der wir ausgesetzt gewesen sein würden (war das jetzt ein Satz?). Dann ging es weiter mit dem Bus. Erste Station: der Duga Radar. Die allein war schon mal der Hammer. Ein hundert Meter hoch und zweihundert Meter lang zieht sich dieses metallene Monstrum durch den Nadelwald, ein Frühwarnsystem für nukleare Aktivitäten im kalten Krieg, denn die Atomwaffen der Sowjets lagerten vornehmlich in der Ukraine und in Weißrussland. An dieser Stelle finden unsere Geigerzähler das erste Mal an, Alarm zu schlagen. „Keine Angst, niemand wird sterben“, war der Kommentar unseres Guides, der unbeirrt weitererzähle. Gut. Keiner war nervös, also wollte ich mal auch nicht nervös werden. Und die Guides waren schließlich jeden Tag hier, konnte also so schlimm tatsächlich nicht sein. Der Geigerzähler meldete sich immer dann, wenn die atmosphärische Strahlung mehr als 0,3 Micosievert pro Stunde betrug. Die normale Grundstrahlung in Kiev (und die ist auch höher als an den meistern anderen Orten in Europa) liegt bei ca. 0,15. Die Regierung erlaubt für Wohngebiete nicht mehr als 0,3, weil es dann irgendwann ungesund wird. Aber eben erst dann, wenn man da wohnt, nicht, wenn man sich einen Tag lang dort aufhält. Schon mal im Voraus, damit sich meiner Mutter Puls gleich wieder beruhigt: Die gesamte Strahulngsmenge, der ich an diesem Tag ausgesetzt war, entsprach etwa der Strahlung, die man abbekommt, wenn einen der Zahnarzt mal eben röntgt.
Als wir alle den Duga Radar ausgiebig besichtigt hatten (nochmal, ein hammer Teil) ging es weiter mit dem Bus, zu einem verlassenen Kindergarten. Das war dann eher gruselig. Im Kindergarten war die Strahlung relativ gering, aber vor dem Kindergarten fingen alle Geigerzähler an, wie verrückt zu piepen. „Hier ist die Erde stark verstrahlt“ erklärte unser Guide „also bleibt lieber auf dem Asphalt und tretet nicht in den Modder hier. Ich warte hier auf euch. Ihr habt 15 Minuten, viel länger sollten wir hier nicht sein.“ Gut. Ich also hinein in diesen Kindergarten, entdecken gehen. Ich lasse mal die Bilder für sich sprechen:
Nach den angeküngiten 15 Minuten rief uns unser Guide zurück in den Bus, und unsere Geigerzähler beruigten sich langsam wieder. Es war etwa zwei Uhr Nachmittags, und jetzt wartete das Zentrum des Geschehens auf uns: Der Reaktor.
Was mich in der Exclusion Zone am Meisten bedrückte, war, dass da tatsächlich Menschen wohnen. Ja, richtig gehört. Zwischen der 30km und der 10km Sicherheitszone wohnen in den tristen, hektisch verlassenen Wohnungsblöcken heute wieder eine Hand voll Arbeiter, die im Atomkraftwerk beschäftigt sind. Der letzte Reaktor ist ers 2014 vom Netz gegangen, und jetzt stehen täglich Nachbereitung und natürlich nach wie vor Sicherung an. Wie dieser Arbeiter Leben so aussieht, will ich mir allerdings lieber nicht vostellen müssen. Mit Gemeinschaft und ausgelassenem Tanz ist da, glaube ich, nicht viel. Lasst uns also alle mal eben dankbar sein, dass wir nicht gezwungen sind, im Atomkraftwerk Chernobyl zu arbeiten und in einer Geisterstadt zu wohnen.
Der Reaktor ist, kurz gesagt, selbst relativ unspektakulär. Also, der riesige Stahlsarg, der das Ganze umgibt, ist schon ein ziemliches Gerät, aber es ist eben eine sibler glänzende Kuppel auf weitem Feld, die spricht einen emotional nicht so an. Interessant war hier eher,dass Fotos wirklich nur in Richtung des Reaktors erlaubt waren, da es sich bei alen umgebenden Anlagen (allesamt dicht vermauert und verstacheldrahtet) um „geheime Regierungseinrichtungen“ handelte, was mir an dieser Stelle doch etwas spanisch vorkam, zumal unser Guide zuvor bereits mehrmals bedauert hatte, dass die Ukraine ja „momentan leider gerade keine Atomwaffen besitzt.“ Nun ja. Ich lasse das mal so stehen.

Im Anschluss gab es Mittag in der Kantine, in der auch alle Arbeiter verköstigt wurden. Ich hatte Mittag ja wie gesagt abbestellt und packte Hummus und Brot aus (Gewohnheit). Um in die Kantine hineinzukommen, muss man erstmal durch ein Strahlungsmessgerät. Nur, wenn man überhaupt nicht strahlt, geht die Schranke auf. Also grimmig gucken und durch.
Die Kantine war nochmal eine Zeitreise. Trist und kahl, in einem hellen Mintgrün mit dunkelgrünem Streifen auf Brustöhe gestrichen… und wie nennt man noch gleich diese Lamellen vor den Fenstern? Sah jedenfalls aus wie meine Schule. Linoleumfußboden inbegriffen.
Als alle abgespeist worden waren, mit Rote Beete Salat und Fruchtkompott (und irgendwas mit Buchweizen) fuhr uns unser Klapperbus zum letzten Stop: Der sehr pittoresken Geisterstadt Pripyat. Damals die Perle der Ukraine, eine moderne, neue, reiche Stadt, wurde sie 48h nach der Katastrophe, die die sowjetischen Autoritäten ja so lange wie möglich zu vertuschen versuchten, mit 1000 Bussen evakuiert und ist seitdem leer. Was da passiert ist, ist wirklich Stoff für einen Thriller. Den Einwohnern wurde gesagt, sie würden in spätestens drei Tagen zurückkehren, um eine Massenpanik zu vermeiden. Deshalb haben die meisten von ihnen viele Habseligkeiten einfach dagelassen, vor allem auch ihre Haustiere. Die hat eine eigens dafür losgeschickte Militäreinheit dann einige Wochen später allesamt erschossen. Das ist nur eine der vielen Geschichten, aber wir wollen ja hier nicht depressiv werden.
Social Media Star Pripyats ist eindeutig der verlassene Vergnügungspark, in dem ein rostiges Riesenrad in den Himmel ragt, das wie wild strahlt. Wegen des Metalls und seiner überragenden Höhe ist es einer DER Strahlungshotspots, aber auch hervorragend für Instagram geeignet, denn alle Frauen, die anwesend waren, schmissen sich davor sofort gekonnt in Post und wiesen ihre Männer an, 10 bis 30 leicht unterschiedliche Fotos von ihnen zu schießen. Gut. Jeder, wie er mag. Ihr kriegt hier Bilder, auf denen ich nicht drauf bin, ich hoffe, das ist für alle Anwesenden in Ordnung so.
Von Pripyat aus, ich halte es mal kurz, ging es zurück durch die Militärsperren und eine letzte Strahlugnskontrolle nach Kiev. Es war meine letzte nacht hier, und ich hatte Hlasha und Zhenya zum Abendessen eingeladen, um mich für ihre Gastfreundschaft zu bedanken. Schließlich hatten sie mich doppelt so lange bei sich wohnen lassen, wie ich ursprünglich angefragt hatte, und hatten mich wirklich herzlichst umsorgt. Außerdem waren sie cool. So.
Also trafen wir uns in einem veganen Restaurant, irgendwo in einem Keller im Hipsterviertel von Kiev, aßen, erzählten und lachten, bis uns danach war, uns nach Hause zu verziehen. Ich bat um die Rechnung, und bezahlte 13€ für uns alle zusammen.
Zu Hause angekommen wollten wir allerdings noch nicht aufhören, zu erzählen. Zhenya bestand darauf, mir seine Lieblingsmusik nebst Videos zu zeigen, und das war alles so unheimlich russisch und mir kleinen Deutschen damit so fremd, dass ich es einfach mal mit euch teilen möchte. Sehr also hier:
Zum zweiten Video bemerkte Zhenya: „Da geht es um… wie sagt man das auf Englisch? Auf Russisch sagen wir ‚Gastarbeiterim‘.“ Ich lachte. „Das ist zufällig Deutsch mein Lieber, verstehe schon.“ „Ach, echt? Wieder was gelernt!“
Dann erzählten mir Hlasha und Zhenya, wie sie sich kennengelernt hatten, as Zhenyas Familie 2014 von der Krim in Hlashas Heiatstadt gezogen war. Wie Zhenya von 14 bis 16 stark drogenabhängig war, abhängig von „allem, außer Injektionen“, und dass das bei so vielen Jugendlichen in der Ukraine der Fall war. „Die meiste Zeit unserer Geschichte waren wie von irgendwem okkupiert. Das Bild von dem armen, kleinen Ukrainer, der für andere arbeiten muss und dem es schlecht geht, ist so tief in unserer Gesellschaft verankert, man spürt es an jeder Stelle“ sagte Hlasha „Hast du es gemerkt? Ich finde, es liegt in der Luft. Wir sind alle depressiv, und deswegen nehmen die Teenager eben Drogen. Damit sie an nichts denken müssen, denn wenn sie denken, ist es oft irgendwas schlechtes.“
„Wann hast du denn mit den Drogen aufgehört?“ frage ich Zhenya. „Als ich Hlasha kennengelernt habe“ sagt er, und schaut seine Freundin an „als ich sie kennengelernt habe, habe ich mit den Drogen schluss gemacht.“ Beide lächeln. Irgendwie schön.
„Bist du mal mit der Polizei aneinandergeraten?“ will Zhenya wissen. „Nein“ sage ich „ich war einmal in einer routinemäßigen Verkehrskontrolle, als ich mit 18 von einer Party nach Hause gefahren bin, das war’s dann aber.“ „Hm hm“ sagt er, und nickt.
„Und du?“ frage ich
„Zehn mal. Und sieben Mal haben sie mich verprügelt.“
„Warum das denn?!“
„Wegen gar nichts.“
„Verstehe ich nicht.“
„Unsere Polizei, vor allem damals auf der Krim, war im Prinzip nur eine… wie sagt man?“
„Miliz“ hilft Hlasha ihrem Freund aus
„Ja, eine Miliz. Und die wussten, dass ihnen niemand was tut, wenn sie was falsch machen. Und sie waren wütend, irgendwie immer so wütend.“
Hlasha übernimmt, weil Zhenya mit seinem Englisch am Ende ist: „Das ist vielen von meinen Freunden passiert, gerade, als sie junge Teenager waren. Die sind aufmüpfig und können sich nicht wehren, die perfekten Opfer. Also schlägt die Polizei sie eben. So ist das hier.“
Dann fragen sie nach der Polizei in Deutschland, und ich will eigentlich lieber gar nichts sagen, so schlecht fühle ich mich, weil es mir so gut geht. Ich erkläre also so kurz wie möglich, wie es in Deutschland aussieht.
„Muss schön sein“ sagen beide und nicken.
„Ist schön.“ denke ich „ist wirklich ziemlich schön.“











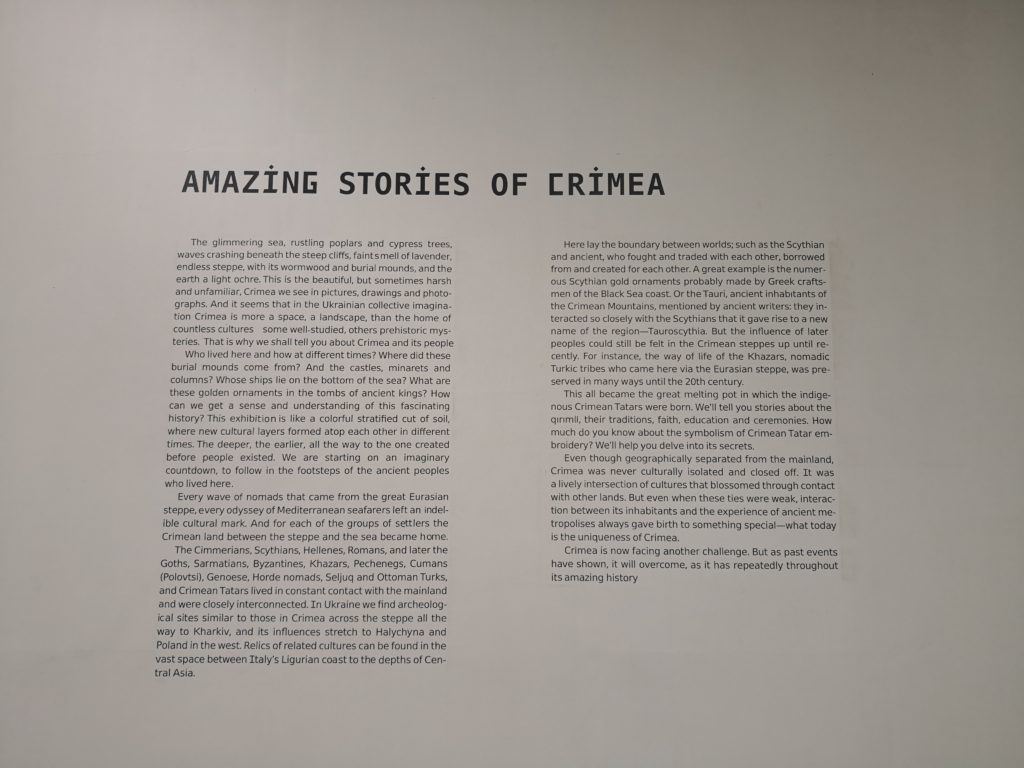





















































Eine Antwort auf „Chernobyl, Pripyat und Polizeigewalt“
liebe klara, so einen bericht habe ich von dir erwartet. okay und danke, daß du auch für mich nach tschernobyl gefahren bist. anscheinend saß kafka mit euch im bus und der hat dir geflüstert, wie man das so schreiben soll. es ist einfach nur unglaublich und überhaupt deine erlebnisse in der ukraine. sie werden dich noch schlauer machen. das gehört wieder mal zu den dingen, die man sich nicht vorstellen kann.
und du bnist wieder mal sehr tapfer!
manches ist ja auch lustig, bestimmt die toilettengeschichte ( ich liebe sowjetische toiletten! ) mein schärfstes erlebnis – alma ata 1980 ) stzt noch einen drauf. bei einem tagesausflug mit busrundfahrt hatte ich noch meine regel und die war immer deftig. ichmusste auf die klos , auch wenn ich nicht wollte. wir kamen 2x an derselben vorbei. dort war charmanterweise aber das „LOCH“ schon seit langem verstopft und der berg entwickelte sich in die höhe der die stadt umgebenden berge……… es reicht, nun kann jeder seine phantasie arbeiten lassen. von meiner kaukasusreisenden mutter hörte ich dieselben stories. so wurde ddr-bürgern immerhin was besonderes geboten!
keine weiteren kommentare zu deinen freundlichen gastgebern…..ich werde versuchen, meine ukrainische putzfrau noch mehr zu verhätscheln und mit kleinigkeiten zu erfreuen.
ja, ich warte auf lemberg und tschernowitz. kann man noch was fühlen von der zeit als es dort ein „Nest“ bedeutender schriftsteller gab?
pass aufdich auf, liebe grüße von inge